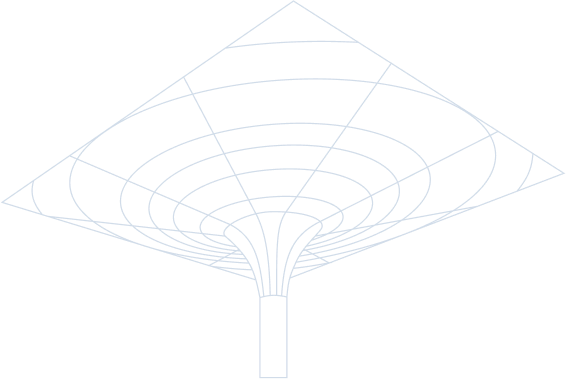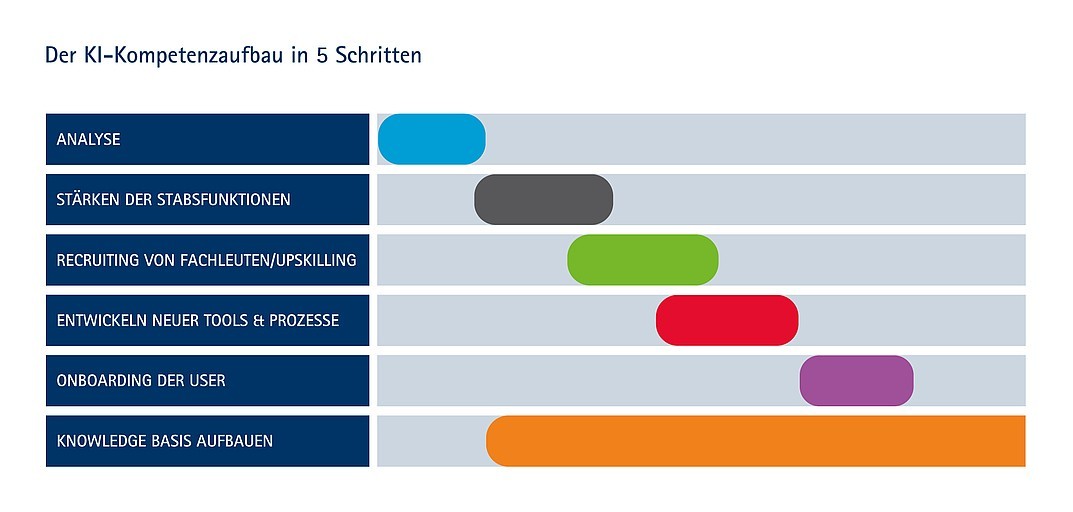KI findet in zahlreichen Bereichen Anwendung. Dazu gehören autonomes Fahren, vorausschauende Wartung und Prozessoptimierung in der Industrie, Analysen in Chemie und Medizin oder das Generieren von (Bewegt-)Bildern.
Chatbots stellen dabei nur einen Teil des großen KI-Spektrums dar, wenn auch einen sehr bekannten.