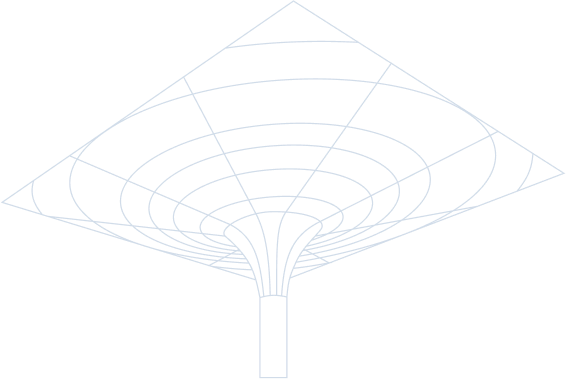Um die Insolvenz eines Unternehmens als Sanierungschance nutzen zu können, sollte in der Unternehmenskrise möglichst frühzeitig ein Insolvenzantrag gestellt werden. Für den Schuldner gibt es deshalb die Möglichkeit, schon bei drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag zu stellen. Neuerdings kann damit zugleich ein Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt werden (§ 270b InsO). Es handelt sich dabei um ein Verfahren zur Vorbereitung einer Sanierung durch einen Insolvenzplan in Kombination mit Eigenverwaltung, d. h. durch den Schuldnern selbst unter Aufsicht eines Sachwalters. Ist ein insolventes Unternehmen sanierungsfähig, kommen insbesondere folgende Sanierungswege in Betracht:
Die übertragende Sanierung
Anstatt einer Zerschlagung des insolventen Betriebes kann im Wege der so genannten übertragenden Sanierung der Betrieb oder ein Teilbetrieb an ein anderes Unternehmen veräußert werden. Die Veräußerung erfolgt durch Verkauf der einzelnen Sachen, Rechte und sonstigen Vermögenswerte (so genannter „Asset Deal“). Verkäufer ist der Insolvenzverwalter. Durch diese Konstruktion verbleiben die gesamten Verbindlichkeiten beim insolventen Unternehmen. Das insolvente Unternehmen durchläuft das Insolvenzverfahren und wird zerschlagen. Der Erwerber muss nicht nach § 25 Handelsgesetzbuch (HGB) für die Altverbindlichkeiten einstehen, wenn der Insolvenzverwalter das Handelsgeschäft im eröffneten Verfahren erworben hat. Darüber hinaus haftet der Erwerber, der das Unternehmen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens erwirbt, auch nicht für die Betriebssteuern gem. § 75 Abgabenordnung (AO).
Größtes Hindernis für eine übertragende Sanierung ist in der Praxis allerdings oft die Vorschrift des § 613a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zum Betriebsübergang, wonach der Erwerber in die Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen eintritt. Wichtig ist eine frühe und sorgfältige Planung und Vorbereitung der übertragenden Sanierung – möglichst schon im vorläufigen Insolvenzverfahren. Der potenzielle Erwerber will so viele Informationen wie möglich erhalten. Einer Beratung durch Sanierungsspezialisten ist dringend anzuraten.
Der Insolvenzplan
Der Insolvenzplan soll die Möglichkeit eröffnen, eine Insolvenz einvernehmlich und durch den Schuldner / die Gläubiger gesteuert abzuwickeln (§§ 217 ff. InsO). Er kann vielfältige Ausgestaltungen haben und ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität. Die Gläubiger sind umfassend am Verfahren beteiligt. Im Insolvenzplan kann von den Vorschriften der Insolvenzordnung abgewichen werden, wenn dies zu einer besseren und wirtschaftlich effektiveren Verwirklichung der Gläubigerbefriedigung führt. Im Insolvenzplan kann auch eine Liquidation, eine übertragende Sanierung oder die Reorganisation des Unternehmens geregelt werden. Auch Mischformen sind möglich. Im Gegensatz zur übertragenden Sanierung bleibt der alte Unternehmensträger bei der Sanierung durch Insolvenzplan erhalten und wird fortgeführt.
Erstellung des Insolvenzplans
Zur Erstellung und Vorlage eines Insolvenzplans berechtigt sind der Schuldner und der Insolvenzverwalter. Den Gläubigern steht kein eigenes Initiativrecht zu. Die Gläubigerversammlung kann aber den Insolvenzverwalter unter Vorgabe bestimmter Planziele beauftragen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten und durch diese Vorgaben starken Einfluss auf die Ausgestaltung des Plans nehmen. Der Plan muss einen darstellenden Teil enthalten, der das bisherige Geschehen, die Grundlagen und die Auswirkungen des Plans beschreibt und einen gestaltenden Teil, in dem festgelegt wird, wie die Rechtsstellung der Beteiligten durch den Plan geändert werden soll. Der darstellende Teil soll den Gläubigern die Möglichkeit geben, anhand umfassender Informationen darüber zu entscheiden, ob der Plan angenommen wird. Es empfiehlt sich hier, einen Vergleich zwischen den Befriedigungsaussichten des einzelnen Gläubigers ohne Plan bei Zerschlagung des Unternehmens und den Befriedigungsaussichten, die sich mit Plan ergeben können, zu ziehen. Zum gestaltenden Teil gehören zum Beispiel Aussagen, welche Forderungen voll erfüllt werden, welche gestundet und welche erlassen werden sollen. Bei der Festlegung der Rechte der Beteiligten im Insolvenzplan sind Gruppen zu bilden, soweit Gläubiger mit unterschiedlicher Rechtsstellung betroffen sind.
Gestaltungsmöglichkeiten
Die Insolvenzordnung gibt eine Reihe an Möglichkeiten zur Gestaltung eines Insolvenzplans, die zu erfolgreichen Sanierungen führen können. Dazu gehört das Instrument „Debt-to-Equitiy-Swap“, durch das im Insolvenzplan vorgesehen werden kann, dass Forderungen von Gläubigern in Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte am Schuldnerunternehmen umgewandelt werden (§ 225 a Abs. 2 InsO). Da hierdurch die Widerstände von Altgesellschaftern überwunden werden können, verbessern sich die Chancen auf eine erfolgreiche Unternehmenssanierung.
Im Plan kann darüber hinaus jede Regelung getroffen werden, die gesellschaftsrechtlich zulässig ist, insbesondere die Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft oder die Übertragung von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten (§ 225 a Abs. 3 InsO). Dies führt zu einer Abkehr von der bisherigen strikten Trennung zwischen Insolvenz- und Gesellschaftsrecht. Im Wesentlichen bezwecken die Gesetzesänderungen beim Insolvenzplanverfahren, Verfahrenshindernisse auf dem Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung eines Insolvenzplans zu beseitigen. Wichtige Änderungen finden sich auch in Eingriffsmöglichkeiten in Rechte der absonderungsberechtigten Gläubiger und Insolvenzgläubiger (§§ 223 f. InsO) und in der Einbeziehung von Gesellschaftern in den Insolvenzplan (§ 217 Satz 2 InsO). Die Gesellschafter stellen dann eine eigene „Gläubigergruppe“ dar.
Weiteres Vorgehen
Der Insolvenzplan ist dem Insolvenzgericht vorzulegen, das ihn auf Formalia überprüft. Anschließend wird der Plan dem Gläubigerausschuss und dem Schuldner bzw. Insolvenzverwalter (je nachdem, wer ihn vorgelegt hat), zur Stellungnahme übersandt. In einem Erörterungs- und Abstimmungstermin muss der Insolvenzplan durch einen Beschluss der Gläubiger angenommen werden. Die Gläubiger stimmen in den festgelegten Gruppen ab. Jede Gruppe stimmt gesondert über den Insolvenzplan ab. Der Plan ist angenommen, wenn in jeder Gruppe eine Kopf- und Summenmehrheit erreicht wird (§ 244 InsO). Auch die Zustimmung des Schuldners ist erforderlich.
Abschließend muss der Plan vom Insolvenzgericht bestätigt werden. Durch eine angemessene Beschränkung der Rechtsmittel gegen die Planbestätigung soll erreicht werden, dass das Wirksamwerden des Plans nicht mehr durch missbräuchliches Verhalten einzelner Gläubiger verhindert werden kann (Obstruktionsverbot, § 245 InsO). Dieses soll verhindern, dass ein wirtschaftlich sinnvoller Plan am Widerstand einzelner Gläubiger scheitert. Kommt die erforderliche Mehrheit in einer Gruppe nicht zustande, gilt deren Zustimmung trotzdem als erteilt, wenn die Gläubiger der betreffenden Gruppe durch den Plan nicht schlechter gestellt werden, als sie ohne den Plan stünden, und wenn diese Gläubiger angemessen an dem wirtschaftlichen Wert beteiligt werden, der den Beteiligten auf der Grundlage des Plans zufließen soll.
Bislang war ausreichend für die Versagung der Planbestätigung, dass Gläubiger eine angebliche Schlechterstellung durch den Plan glaubhaft gemacht haben. Künftig müssen weitere Voraussetzungen vorliegen. Eine sofortige Beschwerde gegen den Planbestätigungsbeschluss wird somit in Zukunft seltener zu einer Abweisung des Plans führen als bisher. Auch Altgesellschafter können sich nicht ohne weiteres gegen die im vorgeschlagenen Insolvenzplan enthaltenen Lösungen wehren. Für sie gilt ein besonderes Obstruktionsverbot (§ 245 Abs. 3 InsO). Eine Schlechterstellung durch den Plan kann jedenfalls dann nicht erfolgreich behauptet werden, wenn ohne ihn die Sanierung scheitert und der Anteil des Gesellschafters damit wertlos wäre.
Auswirkungen des Insolvenzplanverfahrens
Die Wirkungen eines rechtskräftig bestätigten Insolvenzplans treten für und gegen alle Beteiligten ein, also auch gegenüber Insolvenzgläubigern, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben und gegenüber Beteiligten, die dem Plan widersprochen haben. Gerät allerdings der Schuldner mit der Erfüllung des Plans gegenüber einem Gläubiger erheblich in Rückstand, werden für diesen Gläubiger im Plan vorgesehene Stundungen oder ein teilweiser Erlass von Forderungen hinfällig. Gläubiger können aus dem Plan in Verbindung mit der Eintragung in die Tabelle wegen festgestellter Forderungen die Zwangsvollstreckung betreiben. Im Insolvenzplan kann vorgesehen werden, dass die Erfüllung des Plans durch den Insolvenzverwalter überwacht wird.
Für erst nach Abschluss des Planverfahrens geltend gemachte Forderungen gilt folgendes: Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einzelner Insolvenzgläubiger, die ihre Forderungen bis zum Abstimmungstermin nicht angemeldet haben, können untersagt oder einstweilig eingestellt werden, soweit die Durchführung des Insolvenzplans gefährdet wäre (§ 259 a InsO). Forderungen, die nicht bis zum Abstimmungstermin angemeldet worden sind, unterliegen einer Verjährungsfrist von einem Jahr (§ 259 b InsO).
Mit dem Insolvenzplanverfahren können knapp die Hälfte der erhaltungsfähigen Unternehmen fortgeführt (MIMO, Creditreform) und fast 60 Prozent der betroffenen Arbeitsplätze gerettet werden (Institut für Mittelstandsforschung). Ungesicherte Gläubiger erhalten zudem im sanierungsorientierten Planverfahren für ihre Forderungen normalerweise eine Quote von 13 - 20 Prozent, in Einzelfällen sogar über 30 Prozent und damit weit mehr als im Regelinsolvenzverfahren (in der Regel unter 5 Prozent). Bislang wurde von Insolvenzplanverfahren wegen struktureller Mängel des Verfahrens kaum Gebrauch gemacht. Dabei bietet das Planverfahren gerade in Kombination mit der Eigenverwaltung, bei der die Leitung des Unternehmens in den Händen der Geschäftsführung unter Aufsicht des Insolvenzverwalters verbleibt, Unternehmen die Möglichkeit, gut vorbereitet in ein Insolvenzverfahren einzutreten.